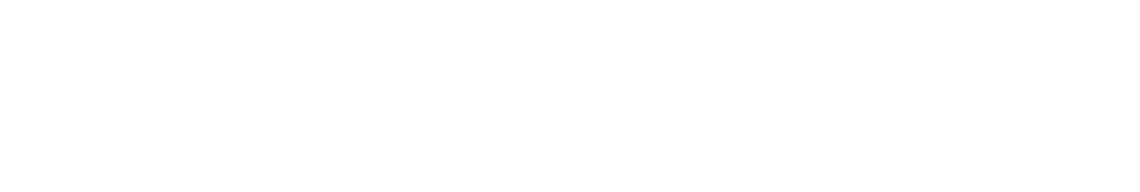Geschichte von Glatzen und Keiserwald
Fürst Schönburg-Waldenburg muss bei seiner ersten Jagd im Kaiserwald ein positives Gefühl gehabt haben. Die tiefen Wälder, die eine weite Wiese mit einem See umgeben, der sanft in das Moor mündet, verzauberten ihn so sehr, dass er 1873 ein weitläufiges Waldgebiet kaufte. Seit mehr als 300 Jahren wird es zu Bergbauzwecken verwendet, hauptsächlich als Wasser und Holzreservoir für den Betrieb von Bergwerken und Schmelzhütten. Nach dem Rückgang der Bergbautätigkeit, Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, wurde dieses Gebiet an das Wiener Konsortium verkauft, das dann per Auktionserlass weiterverkauft wurde.

Ein Teil des Territoriums wird von der Stadt Elbogen und dem Glatzenwald erworben, und der zentrale Teil des Kaiserwaldes geht in den Besitz der Adelsfamilie von Schönburg-Waldenburg über. Das Waldgrundstück mit einer Fläche von 4103 ha Wald und 383 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche hat sich zu einem renommierten Jagdgebiet mit hohen Beständen von Hirsch- und Auerhahnarten entwickelt. Aufgrund des rauen Klimas in Kladska (Glatzen) kauft der Fürst zwei Meierhöfe. Einen in Rockendorf (Žitná) und den anderen in Schönlind (Krásná Lípa) für die Selbstversorgung mit Lebensmitteln. Einmal in der Woche fuhr eine Pferdekutsche aus Glatzen zu den Meierhöfen und brachte den Bewohnern der Siedlung Glatzen und ihren Gästen das nötige Essen.
Der Eigentümer wählte die Glatzen-Wiese mit einem See als Zentrum des neu angelegten Forstgutes, die sich auf einem Plateau unterhalb des Glatzen-Hügels befand und wo unter anderem auch eine Dampfsäge, mehrere Wirtschaftsbauten und eine Jagdhütte standen Hier beginnt die wunderbare Geschichte dieses magischen Ortes.

Fürst Otto Friedrich Schönburg-Waldenburg hat als großer Jäger und Liebhaber von Hirschen und Auerhähnen den Bau des Zentrums seines Jagdreviers mit großer Liebe geplant, die jeder Besucher auch heute spüren muss. Nach dem Brand der Dampfsäge begann er mit dem Aufbau von Glatzen. Er wählte das architektonische Konzept im alpinen Stil der auf tschechischem Gebiet einzigartigen Berner Region. Hier entsteht ein Jagdschloss im Erdgeschoss mit einem Bauernhof. Der hölzerne Teil des Schlosses wurde in Interlaken in der Schweiz hergestellt und mit 22 Eisenbahnwaggons nach Petschau (Bečov) transportiert. Von dort aus wurden diese nach Glatzen transportiert, wo diese Teile von Schweizer Tischlern zusammengebaut wurden. Außerdem baut der Fürst eine Kneipe „Beim balzenden Auerhahn“ („U tokajícího tetřeva“).

Ebenso entstehen weitere Gebäude, die nach und nach durch seinen Erben und Nachfolger Prinz Sigismund Schönburg-Waldenburg (1866-1936) ergänzt werden. Es wurden ein Forsthaus, ein Renthaus, Blockhütten für Angestellte, Wildhüter „Königsstein“ und Einsiedelei-gebiete. Alles aus dem Atelier des Zürcher Architekten Jacques Gros. Die einzelnen Hütten, auch Chaletten genannt, wurden sensibel in eine atemberaubende Umgebung eingebettet, die von der Natur in Harmonie mit menschlichen Händen geschaffen wurden.
Bereits im 16. Jahrhundert wurde ein künstlicher Stausee mit Wasser aus Torfmooren und einem künstlichen Kanal namens „Dlouhá stoka“ (Abflusskanal) im deutschen Flößgraben, heute kurz Floss, gebaut. Es ähnelt dem Schwarzenberger Kanal im Böhmerwald. Der lange Abwasserkanal versorgte die Schmelzütten in Schönfeld (Krásno) und Schlagenwald (Horní Slavkov) mit Wasser, das benötigt wurde, um Edelmetalle aus den abgebauten Erzen zu gewinnen.
Es ist während des Lebens von Prinz Sigismund Schönburg-Waldenburg, kommt es zu der außergewöhnlichen Blüte von Kladska (Glatzen). Der gesamte Gutbesitz wurde mit viel Liebe und Gespür für die einzigartige Landschaft gebaut, was sich durch eine Kombination aus natürlichen Bedingungen und historischen Bauarbeiten auszeichnet.

Das ungewöhnliche Gespür des Eigentümers für die landschaftliche Gestaltung entsprechend der wirtschaftlichen Nutzung seines Gutbesitzes kann der heutige Besucher nicht nur in Glatzen, sondern auch in seiner Umgebung auf seinen Wanderungen durch diese einzigartige Region bestaunen. Reste von Parkänderungen mit Rhododendron-Bepflanzung, übrigens auf der höchsten Höhe in Böhmen, sind noch heute zu bewundern.
Die Jagdleidenschaft des Prinzen machte den Gutbesitz „Glatzen“ zu einem der herausragenden Jagdgebiete der Zeit in Europa. Die geografische Lage des Landkreises im Komplex des Kaiserwaldes ermöglichte den Bau eines Modelljagdgebietes, dessen Bekanntheit bis heute erhalten geblieben ist. Die Vorliebe für Hirsche, aber auch für Auerhähne führte den Besitzer zu einem lustigen Fahrverbot auf einer Privatstraße von Marienbad um die Jagdhütte Königsstein nach Glatzen, gerade wegen der Wildstörung. Nur Kutschen, die die Kurgäste des berühmten Restaurants „Beim balzenden Auerhahn“ hinfuhren, durften diese Strecke passieren. Autos mussten eine wesentlich längere Route durch Sangerberg wählen. Diese Regelung wurde so strikt eingehalten, dass ihr auch der Präsident T. G. Masaryk bei seinem Besuch in Glatzen nachkommen musste.

Die Tatsache, dass der Eigentümer des Anwesens die kostbare Natur der Umgebung von Glatzen kannte, wird durch die Erklärung der örtlichen Moore als Naturschutzgebiet belegt, die er persönlich förderte.
Dass Prinz Sigismund ein großer Liebhaber der lokalen Natur und Landschaft war, zeigt der Wunsch, in Kladska (Glatzen) der lokalen Sümpfe in Glatzen als Naturschutzgebiet zu erklären, was er persönlich durchgesetzt hat. Nach seinem Tod im Jahr 1936 wurden seine sterblichen Überreste in einem Waldgruft oberhalb von Glatzen aufbewahrt. Die Beerdigung wurde von Förstern und Jägern aus einem weiten Gebiet besucht.
Nach dem Tod des Prinz verwaltete seine Frau Elfriede das Anwesen (Gutbesitz). Das Gebiet von Glatzen und das Jagdrevier wurden weiterhin für die Jagd auf Hirsche genutzt. Das bedeutende Dritte Reich und seine von Herman Göring prominenten Gäste jagten hier auch. Am Ende des Krieges wurde hier ein Ausbildungszentrum der berüchtigten Abschlepporganisation „Werwolf“ sowie auch in ähnlichen Einrichtungen rund um Marienbad eingerichtet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden auch die deutschen Bewohner aus Glatzen vertrieben, die Besitzerin des Gutes starb schließlich 1961 im Schweizer Sanatorium am Bodensee.

1948 endet die kurze Nachkriegszeit der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung mit der Ernennung eines nationalen Verwalters für ein Waldgut und dem Versuch, vom Landesinneren aus umzusiedeln. Das Militärgebiet von „Prameny“ wurde deklariert und der Kaiserwald in Slavkov-Wald umbenannt, das Gebiet von Glatzen wurde von der Armee übernommen. Das Militärgebiet umfasste fast den gesamten Kaiserwald, der von der Linie Marienbad – Petschau – Schönfeld – Falkenau – Königsberg an der Eger – Miltigau – Bad Königswart begrenzt wird. Die Dorfbewohner, einschließlich der Stadt Čistá (ehemals Litrbachy), wurden vertrieben und nach und nach von Truppen, die üben, flachgedrückt. Das tatsächliche militärische Trainingsregime, der Arbeitskräftemangel und die Unzugänglichkeit ermöglichten keine ausreichende Bewirtschaftung der Wälder und der Landwirtschaft. Das ganze Gebiet ist schnell devastiert und verwüstet worden. Indem in Glatzen das Privateigentum durch das gewöhnliche Eigentum aller Menschen ersetzt wird, nimmt alles rasch allmählich ab. Das Jagdschloss wird als Militärschule für Jugendliche in der Forstwirtschaft genutzt, die von Valdek in Brdy hierher gezogen sind. Weitere Gebäude für den Forstbetrieb, Arma-Laden, Bauten fürs Unterbringung von Leiharbeitern dienten der Unterbringung der Hilfsbataillonen PTP. Das Geld für die routinemäßige Instandhaltung von Gebäuden in der Nachkriegszeit war nicht sehr hoch und daher ist die langsame Verschlechterung sowie auch sicherer Verfall angetreten.
Dem ganzen Slavkov-Wald ist es ähnlich ergangen. Ausgesiedelte Dörfer dienten der Armee als Übungsplätzen, was sie in kürzester Zeit in Ruinen verwandelt. Durch Militärtechnik zerstörte Straßen sind schlecht erhalten und erschweren die landwirtschaftliche Bewirtschaftung, insbesondere für die Forstwirtschaft.

Der seit dem Mittelalter gehandelte Edelmetallreichtum führte zu umfangreichen geologischen Untersuchungen, die das Vorkommen des damals stark nachgefragten Urans bestätigten. Das mit der notwendigen geologischen Untersuchung verbundene gestiegene Interesse des Staates am Uranerzabbau im Gebiet des Slavkov-Waldes war jedoch nicht mit der Ausbildung von Truppen zu verbinden. Die Bedeutung des Uranerzabbaus überwiegt allmählich die Interessen des Militärs. Daher wurde 1954 das Übungsgebiet im Slavkov-Wald abgeschafft und in das Duppau-Gebirge verlegt. Die Wiederherstellung des zerstörten Gebiets war lange Zeit unter der Aufsicht des Landwirtschaftsministeriums. Das ehemalige Waldgrundstück Glatzen einschließlich des ausgewiesenen Jagdreviers wurde in das neu gegründete staatliche Unternehmen Gemeinsame Land- und Forstwirtschaftbetribe in Bad Königswart eingegliedert. Der Komplex mit einzigartigen Gebäuden in Glatzen diente der Forstwirtschaft, einem Jagdschloss, in dem Jagdgäste von prominenten Leuten des Regimes untergebracht waren, die in den umliegenden Wäldern Hirsche jagten. Ein schwerer Schlag für Glatzen war der Brand des Schlosses im Jahr 1963. Glücklicherweise wurde der ausgebrannte rechte Flügel zu dieser Zeit erfolgreich rekonstruiert. Aus dieser Zeit stammt auch die große Statue eines Hirsches an der Kreuzung der Straßen zu Sangerberg und Marienbad und der Bau von vier Doppelwohnungen namens Hradschin.
Aus heutiger Sicht erscheint es paradox, das lokale Territorium zu verwüsten. Das langfristige Fehlen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung trug zur allmählichen Schaffung einzigartiger Biotopen-räume und 1974 zur Ausrufung des Landschaftsschutzgebiets Slavkov-Wald bei.
Nach 1989 bessert sich auch Glatzen allmählich, neue Eigentümer und Mieter einzelner Gebäude rekonstruieren allmählich einzigartige Gebäude und gestalten neu den Landschaft – und Parkbau. Der Naturlehrpfad rund um den See erweitert sich und in einem bereits renovierten ehemaligen Wirtschaftsgebäude wurde ein modernes Informationszentrum geöffnet. Glatzen entwickelt sich langsam wieder zum architektonischen und landschaftlichen Juwel, genauso wie das vom Schweizer Baustil des Architekten Gros und seiner ehemaligen Eigentümer früher geprägt und verschönert wurde.